Fakten vs. Deutungshoheit: Wie die Union den EKOCAN‑Bericht zur Cannabis‑Reform verdreht
Zu kompliziert? 💡 Hier geht es zur Version in einfacher Sprache.
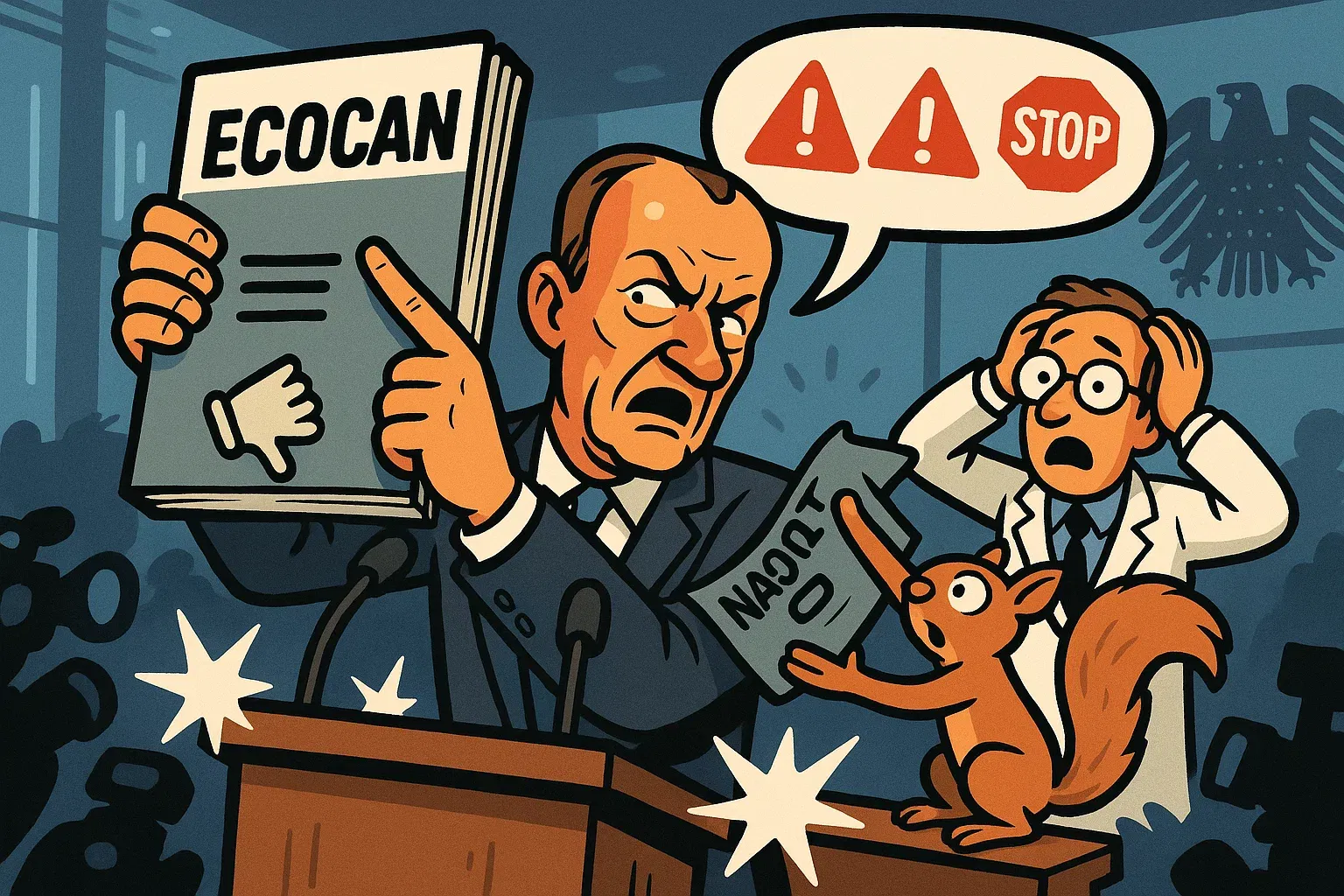
Die Kernfakten in Kürze
- Konsum stabil, Jugendkonsum sinkt: Laut EKOCAN hat sich der leichte Anstieg des Cannabiskonsums bei Erwachsenen fortgesetzt, ohne Sprung – Abwassermessungen bestätigen keinen Boom (BMG). Bei Jugendlichen geht der Konsum seit 2019 weiter zurück (cannabisgesetz‑wirkt).
- Kriminalität bricht ein: Die Zahl der cannabisbezogenen Delikte ist im Hellfeld um 60–80 % gesunken (cannabisgesetz‑wirkt). Das bedeutet eine erhebliche Entlastung für Polizei und Justiz (BMG).
- Medizinalmarkt vs. Clubs: Rund 13–14 % des Bedarfs wird durch Medizinalcannabis gedeckt, Anbauvereinigungen tragen < 0,1 % bei (cannabisgesetz‑wirkt, APOTHEKE ADHOC). Der „Social Supply“, also die (illegal) Weitergabe unter Freunden, spielt eine zentrale Rolle (cannabisgesetz‑wirkt).
- Keine Auffälligkeiten im Straßenverkehr: Erste Daten zeigen keine signifikanten Veränderungen bei Unfällen oder Verkehrssicherheit (BMG). Die Evaluation warnt vor voreiligen Schlussfolgerungen.
- Kein dringender Änderungsbedarf: Das Expertenteam sieht derzeit keinen Grund, das Gesetz zurückzudrehen (RSW Beck). Dennoch fordert die Union eine Rückabwicklung und verweist auf angebliche Jugendschutz‑ und Sicherheitsprobleme (APOTHEKE ADHOC).
Das Forschungsverbund EKOCAN unter Leitung des Universitätsklinikums Hamburg‑Eppendorf hat im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums Daten zu Konsum, Markt, Gesundheitsschutz und Kriminalität ausgewertet. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:
- Stabiler Konsum bei Erwachsenen: Der seit 2011 beobachtete leichte Anstieg der 12‑Monats‑Prävalenz setzt sich fort; ein sprunghafter Anstieg durch das Gesetz ist nicht nachweisbar (BMG).
- Kinder‑ und Jugendschutz: Die Zahl der Jugendlichen, die Cannabis konsumieren, sinkt weiter (cannabisgesetz‑wirkt). Meldungen an Jugendämter und Suchtberatungen nehmen ebenfalls ab (APOTHEKE ADHOC).
- Gesundheit: Es gibt keine Hinweise auf einen sprunghaften Anstieg von Gesundheitsproblemen (BMG). Ein leichter Anstieg akuter Fälle wird eher mit der generellen Tendenz zur Behandlung erklärt.
- Verkehrssicherheit: In den ersten 18 Monaten zeigen die Daten keine signifikanten Veränderungen bei Unfällen oder Fahren unter Cannabiseinfluss (BMG).
- Marktanteile: Der Gesamtverbrauch beträgt geschätzt 670–823 Tonnen. Medizinalcannabis deckt 13–14 %, Anbauvereinigungen produzieren weniger als 0,1 % (cannabisgesetz‑wirkt, APOTHEKE ADHOC). Maximal 2 % der Konsumierenden könnten überhaupt Mitglied in einer Anbauvereinigung werden. Wichtiger als die Clubs ist der private Eigenanbau und das Teilen unter Freunden („Social Supply“) (cannabisgesetz‑wirkt).
- Kriminalität: Die Teillegalisierung ist die quantitativ bedeutendste Entkriminalisierung der Bundesrepublik. Durch Wegfall konsumnaher Delikte sinkt die Zahl der cannabisbezogenen Straftaten um 60–80 % (cannabisgesetz‑wirkt). Ordnungswidrigkeiten spielen bislang eine untergeordnete Rolle.
- Besitzmengen: Die erlaubten 25 g im öffentlichen Raum reichen den meisten Konsumierenden (cannabisgesetz‑wirkt). Die Polizei kritisiert, dass dadurch Kleindealer schwerer zu fassen sind (APOTHEKE ADHOC). Für den Eigenanbau wird die Diskrepanz zwischen 50 g Besitzgrenze und höheren Erträgen erwähnt, aber es gibt keinen Handlungsbedarf.
Die politische Deutung: Union im Angriffsmodus
Die wissenschaftlichen Daten zeichnen also ein eher unspektakuläres Bild. Dennoch verkündeten führende CDU/CSU‑Politiker unmittelbar nach Veröffentlichung, der Bericht belege das Scheitern der Teillegalisierung. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken warnte in der Deutschen Presse‑Agentur vor „bedenklichen Tendenzen“ und kritisierte die Besitzmengen und THC‑Gehalte. CSU‑Fraktionschef Alexander Hoffmann sprach gegenüber der Tagesschau von einem „Bärendienst für Jugendschutz und Verkehrssicherheit“ – obwohl der Bericht keinen Konsum‑ oder Unfallanstieg zeigt.
Auch der Drogenbeauftragte Hendrik Streeck (CDU) behauptete, die Zahl der Frühinterventionen gehe zurück, weil Jugendliche nicht mehr vor Gericht kämen – und deutete daraus einen Schaden für den Jugendschutz ab. Diese Logik stößt auf Widerspruch: Hilfsangebote sollten nicht an Strafverfahren geknüpft sein. Rechtsanwalt Christian Solmecke kommentierte in einem YouTube‑Video („WBS LEGAL“) diesen Spin: „Mein Fazit ehrlicherweise ist, er hätte dieses Fazit auch gezogen, egal was in dem Bericht drin gestanden hätte.“ Er bezeichnete Streecks Argument, man könne Jugendliche nur über Strafen erreichen, als „gewagte These“. Solmecke weist darauf hin, dass der Bericht die Entlastung der Justiz und die rückläufige Jugendkonsumrate belege – und dass eine ideologisch motivierte Interpretation die Fakten verdreht.
Zwischen den Zeilen: Die ungelösten Probleme bleiben
Natürlich ist nicht alles perfekt. Der Bericht hält fest, dass die Anbauvereinigungen wegen bürokratischer Hürden kaum Wirkung entfalten. Der Schwarzmarkt bleibt relevant, da Social Supply und Eigenanbau die Nachfrage decken, während legale Clubs erst aufgebaut werden müssen. Die Polizei kritisiert, dass Kleindealer durch die 25‑Gramm‑Regelung schwer zu überführen seien. Und es gibt noch keine Daten zu Säule 2 der Legalisierung (lizenzierte Shops), weil diese erst in der politischen Abstimmung festhängt. Diese Punkte sind konstruktive Ansatzstellen für Verbesserungen – sie begründen jedoch keine Rolle rückwärts.
Fazit: Politisches Kalkül schlägt Faktenlage
Die Daten des ersten EKOCAN‑Berichts zeigen, dass die Teillegalisierung weder einen Konsumboom ausgelöst noch die öffentliche Sicherheit beeinträchtigt hat. Im Gegenteil: Die meisten Ziele – Entkriminalisierung, Jugendschutz, Gesundheitsschutz – werden erreicht oder bewegen sich in die richtige Richtung. Anbauvereinigungen bleiben ein Nischenphänomen, Social Supply dominiert und der Schwarzmarkt ist zäh, aber die Forscher sehen keinen Anlass für Panik. Die Union ignoriert diese Fakten und betont die wenigen Schwachstellen, um die Rückabwicklung des Gesetzes zu fordern. Für eine evidenzbasierte Drogenpolitik wäre es sinnvoller, die Evaluation als Grundlage für Verbesserungen zu nutzen – etwa durch den Ausbau legaler Bezugswege, die Entbürokratisierung der Clubs und Bildungsangebote für Jugendliche – statt das Rad zurückzudrehen.
Chancen & Risiken
- Chance: Die Entkriminalisierung entlastet Polizei und Justiz und ermöglicht einen offeneren Umgang mit Konsumierenden. Die Debatte könnte mehr Menschen für evidenzbasierte Politik sensibilisieren und den Weg für Säule 2 (lizenzierte Shops) ebnen.
- Risiko: Politischer Spin droht die öffentliche Wahrnehmung zu verzerren. Wird das Gesetz zurückgedreht oder zu stark verschärft, könnte der Schwarzmarkt wieder wachsen und Konsumierende verlieren den Zugang zu sicheren Produkten und Beratung.
Es ist bemerkenswert, wie die Union die Realität ignoriert. Der EKOCAN‑Bericht zeigt, dass die Teillegalisierung funktioniert: weniger Kriminalität, keine Eskalation beim Konsum und ein schwindender Jugendkonsum. Statt konstruktiv an Verbesserungen zu arbeiten, betreibt die Union Ideologiepolitik – vermutlich, weil Cannabis ein populistisches Reizthema bleibt. Für uns bei BesserGrowen steht fest: Wer sich ernsthaft um Jugend‑ und Gesundheitsschutz sorgt, sollte legale, kontrollierte Märkte und Aufklärung fördern – und nicht den Schwarzmarkt stärken.


Diskussion zum Artikel